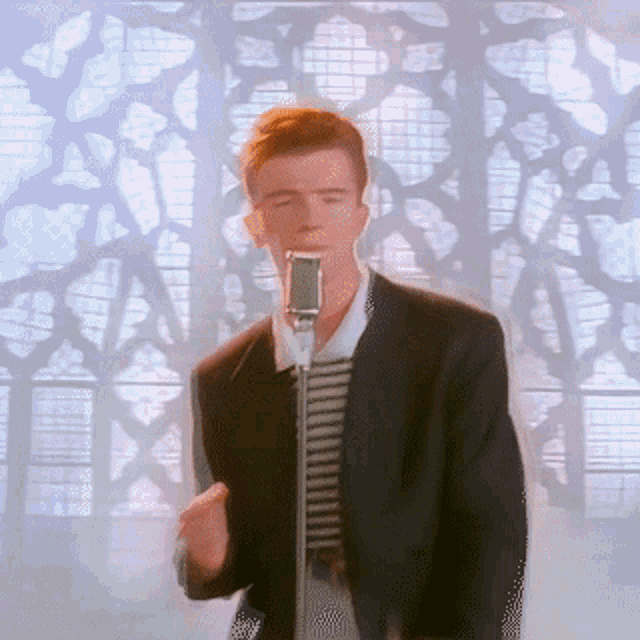Im Rahmen eines moderierten Gesprächs zwischen dem Philosophen Erwin Ott, Begründer der Schattenontologie, und dem spekulativ-realistischen Denker Markus Quentin, moderiert von Peter N. Horst (HR Kultur), wird das Spannungsverhältnis zwischen spekulativem Zugriff auf das Reale und einem Denken der Unverfügbarkeit kritisch ausgelotet.
Ausgangspunkt ist die gemeinsame Einsicht in die Krise gegenwärtiger epistemischer Systeme im Zeitalter der algorithmischen Plattformen. Während Quentin für eine mutige Fortschreibung spekulativer Ontologie eintritt, die im Realen nicht das Unzugängliche, sondern das Herausfordernde erkennt, plädiert Ott für eine Philosophie des Entzugs, die sich dem Imperativ der Sichtbarkeit und Produktivität widersetzt. In Otts Schattenontologie erscheint das Reale nicht als Objekt der Setzung, sondern als Grenze des Sagbaren, als strukturelle Verdunkelung, die dem Denken eine Ethik der Zurückhaltung auferlegt.
Quentin betont demgegenüber die Notwendigkeit, im Strom der Plattformprozesse neue philosophische Interventionen zu wagen – als aktive Antwort auf die Mutation epistemischer Regime. Für ihn ist der spekulative Zugriff kein Rückfall in Ontologismus, sondern ein experimentelles Mittel, um das Denken gegenüber algorithmisch generierten Weltverhältnissen zu öffnen. Zentrale Themen des Gesprächs sind:
- die Plattform als postarchivalisches Wissensregime
- der epistemische Status algorithmischer Sichtbarkeitsproduktion
- die Spannung zwischen Präsenz und Latenz
- Ontologie als Zugriff vs. Ontologie als Verzicht
- die Frage, ob Philosophie unter Bedingungen digitaler Überproduktion noch eine Widerstandsfunktion erfüllen kann
Im Verzicht auf abschließende Synthese wird der Dialog selbst zur performativen Auslotung philosophischer Grenzen: zwischen Diskurs und Schweigen, Spekulation und Entzug, Entfaltung und Exposition. Die Gesprächspartner treten weder affirmativ noch antagonistisch auf, sondern ermöglichen ein Denken in Differenz, das sich in der Uneinlösbarkeit der Positionen ernst nimmt. Das Streitgespräch leistet so einen Beitrag zur zeitgenössischen Debatte um die Rolle der Philosophie im Zeitalter generativer Technologien – nicht durch harmonische Einigung, sondern durch präzise, offene Kontroverse.